Kleine Plauderei unter Freunden

Bild aus „The Tour of Dr. Syntax in Search of the Picturesque“ von Thomas Rowlandson und William Combe (1813)
„Kleine Plauderei unter Freunden“: Unzeitgemäße Gedanken über Erfahrungen mit sich selbst als einem anderen sowie mit Elastizität, Widerstand und Lebensgenuss
Interview mit Jörg Eschenauer
(English version here)
(Version française ici)
von Jörg Eschenauer (Aix-en-Provence, Frankreich)
ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS: Dieser Artikel basiert auf einer Rede, die Jörg Eschenauer, Präsident der PICT-Vereinigung, an der Ecole Nationale des Ponts et Chaussées anlässlich der Verleihung des „Ordre des Palmes académiques“ hielt, einer Auszeichnung, die der französische Staat für herausragende Verdienste auf dem Gebiet der Ausbildung verleiht.
Jörg Eschenauer – französisch (JEF): Lieber Kollege und Freund, ich danke dir, dass du dich anlässlich des Abschlusses deiner beruflichen Laufbahn für dieses Gespräch zur Verfügung stellst. Wie geht es dir an dem Tag, an dem du nach 18 Jahren deine Tätigkeit an der Ecole des Ponts beendest?
Jörg Eschenauer – deutsch (JEA): Ich fühle mich wie auf einem Passübergang, der zwei Berghänge voneinander trennt. Das Berufsleben in meinem Rücken und eine neue Form des aktiven Lebens vor mir. Wenn ich zurückblicke, sehe ich meinen Weg als Ganzes, mit all seinen Abzweigungen und Linien, die manchmal gerade und manchmal voller Kurven sind, mit seinen mehr oder weniger steilen An- und Abstiegen. Ist diese Erfahrung eines kompakten, nicht auf einer linearen Zeitleiste ablaufenden Lebens, bei der sich alles Erlebte als eine gleichzeitige Einheit in meinem Geist wiederfindet, das, was Bergson als Dauer bezeichnet? Vielleicht …
Dieser einzigartige Moment des Loslassens und des Übergangs zu einem kontemplativeren Leben ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und auf diese Weise meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich in einer solchen Situation gezwungen bin, unter anderem auch über meine Person zu sprechen, so wage ich das nur unter einer Bedingung. Kennst du die seltsame Erfahrung, die man macht, wenn man zunehmend älter werdend Abstand von sich selbst nimmt? An einem bestimmten Punkt in unserem fortgeschrittenen Leben beginnen wir, uns „selbst als einen anderen“ zu sehen, um es mit Paul Ricoeur auszudrücken. Das ist übrigens auch der Grund, warum mich Rimbaud mit seinem berühmten Satz „Je est un autre!“ so stark berührt hat. Da das J und das E die Anfangsbuchstaben meines Namens sind, habe ich mich davon immer besonders angesprochen gefühlt.
JEF: Die Tatsache, dass du von Dankbarkeit sprichst, lässt darauf schließen, dass du dein Leben als Geschenk betrachtest. Was würdest du dann über dieses Leben sagen, wenn du es mit diesem doppelten Blick auf dich selbst betrachtest, als ob du ein anderer wärst?
JEA: Ja, so ist es. Die deutsche Sprache hat ein sehr starkes Wort in Bezug auf die Erfahrung, dass etwas von außen auf uns zukommt, ohne dass wir etwas dazu beitragen. „Widerfahrnis“ ist ein Vorfall, ein Ereignis, das „uns entgegenkommt“. Wir sind nie allein Herr an Bord des Schiffes unserer Existenz. Was uns wider Willen oder ohne Absicht widerfährt, kann eine tragische Erfahrung wie eine Krankheit sein, aber auch eine positive Erfahrung, die uns Glück bringt und vielversprechende Perspektiven eröffnet. Es gibt viele Gründe, warum ich diese Dankbarkeit empfinde.
JEF: An wen richtet sich diese Dankbarkeit?
JEA: Zunächst einmal ist es eine Dankbarkeit gegenüber dem Leben, das mir einen sehr abwechslungsreichen Lebenslauf mit völlig unwahrscheinlichen Wendungen geschenkt hat. Darf ich mir eine kleine biopoetische Abweichung erlauben?
JEF: Aber bitte doch! Fühle dich frei zu improvisieren. Wir sind hier in Frankreich. Unser Gespräch ist nur eine kleine Plauderei, nicht wahr? Was meinst du mit „Biopoetik“?
JEA: Ich würde jeden Versuch, dem eigenen Leben, der eigenen Biografie einen poetischen Sinn zu verleihen, als „Biopoetik“ bezeichnen. Es handelt sich um das Gegenteil von „Storytelling“, das heute so in Mode ist. Beim Storytelling werden unsere Leistungen, unser sozialer Erfolg und unsere Person als Vorbild hervorgehoben. Eine biopoetische Lesart unseres Lebens tut genau das Gegenteil: Sie illustriert die überraschende Seite unseres Lebens, unsere irreduzible Einzigartigkeit und all das, was uns widerfahren ist, ohne dass wir es uns je erarbeitet hätten. Nehmen wir zum Beispiel unseren Namen, den wir uns natürlich nicht ausgesucht haben. Eschenauer bedeutet: „Der Mann, der auf der Eschenlichtung lebt“, und er wurde in der Stadt Aue (in Sachsen) geboren, was eben „Lichtung“ bedeutet. 68 Jahre später findet derselbe Mann sich in Aix-en-Provence wieder, einer anderen Stadt mit drei Buchstaben, die mit A beginnt. Aix bedeutet Wasserquelle. Was für eine schöne biopoetische Kohärenz, nicht wahr? Diese Kohärenz ist natürlich ohne den geringsten vorherigen Plan unsrerseits entstanden, sondern durch eine Vielzahl von kleinen und großen Entscheidungen angesichts der Wahlmöglichkeiten, die uns das Leben geboten hat! Du weisst ja, dass wir kein vorhersehbares Leben geführt haben, ganz im Gegenteil. Wir wussten während der Wanderung unseres Lebens nie, wie der Pass ins Rentenalter am Ende unseres Berufslebens aussehen würde.
JEF: Du bist in den 80er Jahren von Deutschland nach Frankreich gezogen.
JEA: Ja, das war 1984. Wie Freud schon sagte: Im besten Fall (und das war glücklicherweise meiner) sind es Liebe und/oder Arbeit, die die Menschen bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Ich war wirklich begeistert, dass ich die französische Sprache lernen konnte, als ich zwischen 1984 und 1992 mitten in Paris lebte. Damals arbeitete ich für eine deutsche protestantische Organisation in West-Berlin, die jungen deutschen Erwachsenen einen 18-monatigen Zivildienst in einem Land anbot, das während des Krieges unter den Gräueltaten der Nazi-Besatzer gelitten hatte. Wir waren damals Vorläufer des europäischen Freiwilligendienstes, der auf dem Modell dieser Art von Zivildienst aufbaut. In diesen Jahren hatte ich das Glück, eine französische Gesellschaft zu entdecken, die aus vielen bewundernswerten, humanistischen, solidarischen, engagierten und kreativen Frauen und Männern bestand. Meine verschiedenen beruflichen Tätigkeiten ermöglichten es mir, mich in allen sozialen Milieus zu bewegen: von einer Einrichtung für ältere Menschen wie den Petits Frères des Pauvres über die Shoa-Gedenkstätte bis hin zum Lycée international de Sèvres, der Ecole Polytechnique und der Ecole des Ponts, wo ich etwa dreißig Jahre lang Deutsch und Geschichte unterrichtete.
JEF: Wie siehst du rückblickend deine Integration in die französische Gesellschaft?
JEA: Als „persischer“ Beobachter nimmt man Dinge wahr, für die ein Einheimischer gar keinen Blick hat, weil sie sich für ihn von selbst verstehen. Das Eintauchen in eine andere Gesellschaft, deren Sprache ich damals noch nicht beherrschte, hat mich dazu gebracht, einen ethnologischen Blick für das Verhalten der Menschen zu entwickeln, mit denen ich zu tun hatte. Ich musste diesen Blick schärfen, um den anderen gegenüber fair zu sein und auch, um mich selbst mit meiner Andersartigkeit nicht zu verlieren. Da liegt sicherlich der Ursprung meines Interesses an der interkulturellen Dimension unserer Existenz. Mein Leben in Frankreich hat mich daher sehr bereichert. Es ist unmöglich, hier in wenigen Worten die Gesamtheit dieser Verschmelzungen zusammenzufassen, die ich heute als sehr tiefgreifend und insgesamt als eher gelungen betrachte.
JEF: Erzähl uns mindestens eine interkulturelle Erfahrung, die dich besonders geprägt hat!
JEA: Dann beschränke ich mich auf eine einzige Anekdote, die viel über den Unterschied der kulturellen Bezugsrahmen Frankreichs und Deutschlands aussagt. Es handelt sich um eine Art von kritischem Vorfall, der mich zunächst schockiert und dann im positiven Sinne verändert hat. Es war im Winter 1985/86 bei sehr kalten Temperaturen von -20 Grad, als sich an den Dachrändern riesige Eiszapfen bildeten, die, mal auftauend und dann wieder gefrierend, zu einer bedrohlichen Größe von einem Meter und manchmal sogar noch mehr anwuchsen. Als einer dieser Eisblöcke nach seinem Sturz vom Dach eines Pariser Gebäudes im 12e Arrondissement auf dem Bürgersteig aufschlug, eilte der junge Deutsche, der sich um die tödlichen Risiken eines solchen herunterfallenden Eisbrockens sorgte, in eine Parfümerie, um die Verkäuferin vor der Lebensgefahr zu warnen, die über ihrem Kopf schwebte, falls sie sich entschließen sollte, auf den Bürgersteig zu gehen. Während wir vorsichtig den Zustand des Eisblocks über unseren Köpfen betrachteten, sagte ein Mann, der ruhig auf seinem Weg vorbeikam, mit Blick zum Himmel: „Irgendwann muss man ja sowieso sterben!“. Ich konnte ihm in Bezug auf unsere unvermeidliche Endlichkeit nur zustimmen, aber für mich war es keineswegs der richtige Zeitpunkt, um das Risiko einzugehen, „hier und jetzt“ zu sterben.
Nach diesem Vorfall dachte ich viel darüber nach, inwieweit eine gute Portion „französischer“ Leichtigkeit und Selbstironie meine moralische Überempfindlichkeit eines nach dem Krieg geborenen Deutschen etwas verringern könnte. Dies ist ein Beispiel für eine gelungene Verschmelzung, auch wenn ich grundsätzlich einer gewissen ethischen Konsequenz, die durch die unglückliche Geschichte meines Landes hervorgerufen wurde, sehr verbunden geblieben bin. Ich habe durch diesen Vorfall gelernt, dass wohldosierte Selbstironie und Ironie überhaupt für mein persönliches Alltagsleben sehr heilsam sein können. Für die politischen Herausforderungen unserer Gesellschaften gilt das nicht unbedingt. 1986 ist in dieser Hinsicht ein besonders bedeutsames Jahr.
JEF: Warum?
JEA: Es ist das Jahr des Tschernobyl-Unfalls.
JEF: Ich wollte nicht zu viel darüber reden…
JEA: Das verstehe ich. Das ist kein sehr glorreiches Kapitel in der Geschichte der Pariser Intelligenzia, die damals mit unendlicher Häme über die völlig irrationalen Deutschen hergezogen ist. Wie konnte man denn bei klarem Verstand befürchten, dass radioaktive Strahlung tausende Kilometer vom Unfallort entfernt in unseren Salat gelangen würde? Der französische Staat verhinderte sogar die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die kurz nach der Katastrophe die Kontamination von Pilzen im Jura und bis nach Südfrankreich bestätigten. Danach funktionierte die Selbstironie à la française wieder wie meistens hier in Frankreich. Da François Mitterrand im April 1986 amerikanischen Militärflugzeugen auf dem Weg nach Libyen den Überflug über französisches Territorium verweigert hatte, hieß es, der französische Präsident habe natürlich auch den Durchzug der russischen Wolken verboten.
Der Vorfall mit dem Eisblock im 12e Arrondissement wie auch der Unfall in Tschernobyl stellen uns eine radikale Frage: Was tun angesichts eines unkalkulierbaren Risikos? Es ist kein Zufall, dass zu dieser Zeit zwei sehr wichtige Bücher von zwei deutschen Autoren geschrieben wurden: Hans Jonas veröffentlichte 1979 „Das Prinzip Verantwortung – Eine Ethik für die technologische Zivilisation“ und Ulrich Beck 1986 „Die Risikogesellschaft – Auf dem Weg zu einer anderen Moderne“. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis der „Herr und (cartesianische) Besitzer der Natur“ mit seinem bedingungslosen Glauben an den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt endgültig mit seinem Dickkopf gegen die Realität stieß.
JEF: Geschichte spielt für dich eine sehr wichtige Rolle. Haben dich die unterschiedlichen Arten, Geschichte in unseren beiden Ländern zu unterrichten, überrascht? Was denkst du darüber als Deutscher, der Geschichte im Kontext des französischen Bildungswesens unterrichtet hat?
JEA: Du sprichst hier zwei sehr wichtige Themen an, über die man nicht kurz sprechen kann, ohne das große Risiko einzugehen, missverstanden zu werden. Im Rahmen dieser Plauderei möchte ich aber wenigstens Folgendes sagen: Ich fand immer sehr schade, dass der französische Geschichtsunterricht meistens auf einem sehr abgehobenen Niveau ablief. In meinem Unterricht habe ich immer versucht, zwei „Geschichten“, die unweigerlich miteinander verwoben sind, parallel zu berücksichtigen: die kollektive Geschichte und die persönliche und familiäre Geschichte meiner Schüler. Ich habe in meinem Unterricht das Konzept der „Eigengeschichte“ von Wilhelm Schapp angewandt, das den je eigenen Weg eines jeden Menschen kennzeichnet, der natürlich Teil der kollektiven Geschichte ist.
Schapp drückt es so aus: „Unser vergangenes Leben steht in den Geschichten der Vergangenheit ständig in der Weise des Horizonts um uns, ohne dass es uns auch nur möglich ist, aus dieser geschichtlichen Welt den Kopf zu erheben, um sie von aussen anzusehen. Wir sehen sie immer nur so, wie der Kopf seinen Körper sieht, den Körper, zu dem er gehört.“ Dieses auf die Unterrichtspädagogik angewandte phänomenologische Prinzip lässt einen außergewöhnlichen Resonanzraum zwischen den verschiedenen „Eigengeschichten“ der Schüler eines Klassenverbands entstehen und ermöglicht so eine konkrete multiperspektivische Beziehung zur Geschichte. Man sollte nicht vergessen, dass das so banale Wort „konkret“ vom lateinischen concrescere = sich verdichten, zusammenwachsen herkommt. Es ist nicht verwunderlich, dass viele Schüler kein lebendiges Interesse an einer Geschichte entwickeln, die als völlig fern von ihrer eigenen Erfahrung empfunden wird.
Wie lautete deine zweite Frage?
JEF: Was hat dich in diesem Kontext des französischen Bildungswesens am meisten überrascht?
JEA: Auch hier gäbe es viel zu sagen. Ich beschränke mich auf einen Aspekt, der sowohl bei Deutschen als auch bei Franzosen ein Lächeln hervorrufen dürfte. Frage heute noch einen französischen Schüler, der seinen Geschichtsstoff gut gelernt hat, ob Karl der Große Franzose war. Er wird wahrscheinlich sagen, dass Charlemagne natürlich Franzose war. Ein paar Kilometer weiter, auf der anderen Seite des Rheins, wird der deutsche Schüler sagen, dass Karl der Große selbstverständlich ein Deutscher war. Die Instrumentalisierung der Figur des Carolus Magnus und seines Heiligen Römischen Reiches funktioniert bis heute bei der stereotypen Wiederholung des immer gleichen fiktiven französischen Nationalnarrativs. Dabei wissen wir, dass es völlig absurd ist, auf das Jahr 800 n. Chr. irgendeine Art von Ursprung der französischen Nation zu projizieren, die erst viel später entstanden ist. Weder Frankreich noch Deutschland existierten zu dieser Zeit.
Im Jahr 2023 wäre es vielleicht an der Zeit, unsere ideologischen Rumpelkammern aufzuräumen und uns von diesen falschen nationalen Visionen zu befreien. An deren Stelle sollte eine Geschichte Europas treten, mit all seinen endlosen Bürgerkriegen und den seltenen, aber umso beeindruckenderen Versuchen einer konstruktiven Föderation. Carolus Magnus würde in einer solchen Perspektive den Platz finden, den er verdient, nämlich als ein Vorläufer, der zur Entstehung einer bestimmten Idee von Europa beigetragen hat, das alle seine Staaten in einer supranationalen Union vereint. Aber wer will heute noch die Herausforderungen unseres Kontinents auf diese Weise deuten? Wie viele Kriege sind noch nötig, bis die Menschen endlich begreifen, dass eine starke Union die einzige friedensfähige Lösung für uns Europäer ist?
JEF: Möchtest du deine Dankbarkeit auch anderen Menschen gegenüber ausdrücken?
JEA: Ich möchte auch meine Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern zum Ausdruck bringen, insbesondere gegenüber meinem Vater, der sich so sehr gewünscht hätte, dass ich in seine beruflichen Fußstapfen trete. Als leidenschaftlicher Ingenieur, Professor für Mechanik und Spezialist für Elastizität baute er auf der ganzen Welt Parabolantennen. Doch sein Sohn fühlte sich leider viel mehr von den Geisteswissenschaften als von den Naturwissenschaften angezogen. Ohne die Ingenieure vor den Kopf stoßen zu wollen, muss ich gestehen, dass ich die Stummheit der Naturwissenschaften angesichts der grundlegenden ethischen Fragen, die das Leben uns stellt, immer langweilig fand. Soll ich ein Kind adoptieren? Soll ich heiraten? Soll ich mich im Widerstand gegen eine soziale oder politische Realität engagieren, die mir Angst macht? Auf solche Fragen wird das erste Gesetz der Thermodynamik niemals eine Antwort geben. Das zweite übrigens auch nicht. Die Antworten auf diese Fragen können nur von Sokrates‘ Seite kommen, d. h. aus dem Denken, das von den Geisteswissenschaften, der Philosophie, den Humanwissenschaften usw. gespeist wird. Und genau diese Wissenschaften sind es, die heute die Ingenieure mit den ethischen und gesellschaftlichen Entscheidungen konfrontieren, die sie angesichts der technologischen und klimatischen Herausforderungen unserer Zeit treffen müssen.
Mein Vater musste Trauerarbeit leisten: „Mein einziger Sohn wird nie Ingenieur werden!“. Da er selbst in interdisziplinären Projekten mit Kollegen aus den Geisteswissenschaften zusammengearbeitet hatte, konnte er diese „schreckliche Erfahrung“ auf intelligente Weise bewältigen. Es ist diese väterliche Elastizität, die meine große Dankbarkeit rechtfertigt. Kannst du dir seine „Erleichterung“ und sein Lächeln vorstellen, als dieser „undankbare“ Sohn schließlich an einer großen Ingenieurschule landete, wenn auch nur als „einfacher“ Vertreter der Geisteswissenschaften und Lehrer für Sprache, Geschichte und Politikwissenschaften? Um diesen Coup zu landen, musste man nach Frankreich auswandern, wo die Grandes Ecoles den Ingenieuren das Erlernen von zwei Sprachen vorschreiben und den Leitern einer Abteilung den Titel „Präsident“ verleihen, was meinen Vater so beeindruckt hat. Ich betrachte immer noch mit großer Ergriffenheit das Foto meiner Eltern, das 2007 vor dem Eingang der Ecole des Ponts aufgenommen wurde. Mein Vater starb im darauffolgenden Jahr.
JEF: Es ist merkwürdig, dass das Konzept der Elastizität ein Bindeglied zwischen dir und deinem Vater zu bilden scheint, wie zwischen den Naturwissenschaften und den Humanwissenschaften.
JEA: Ich war tatsächlich eines Tages erstaunt, als ich feststellte, dass dieses Konzept vielleicht ohne mein Wissen von den Arbeiten meines Vaters in meine Überlegungen zu interkulturellen Kompetenzen gewandert war. Erst im Nachhinein wurde mir klar, dass eine unbewusste Übertragung mir dieses schöne Erbe geschenkt hatte.
JEF: Das Leben, deine Eltern… gibt es noch andere Gründe, um dankbar zu sein?
JEA: Ich bin der französischen Gesellschaft auch sehr dankbar, dass sie mir als Deutschem die Möglichkeit gegeben hat, mit meinem Engagement als Citoyen und Pädagoge auf die wahnsinnigen Kriege des 20. Jahrhunderts zu antworten. Ein ganz bescheidener, aber klarer Beitrag: 1914 verlor meine damals 11-jährige Großmutter ihre drei Brüder, die im Laufe von nur wenigen Tagen in den Schützengräben bei Verdun starben. Noch 1980 erlebte meine Großmutter das Auftauchen einer jungen französischen Frau an meiner Seite mit sehr gemischten Gefühlen. Glücklicherweise hatten meine Eltern keine Ressentiments mehr, aber Frankreich war zu diesem Zeitpunkt immer noch ein entfernter Nachbar, den man in meiner Familie ziemlich schlecht kannte und verstand.
Ich bin sehr glücklich, dass ich durch mein persönliches und berufliches Engagement meinen bescheidenen Beitrag zu einer konstruktiven Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen und der europäischen Geschichte geleistet habe. Sprachen haben immer eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Wissenstransfer und den Austausch zwischen unseren Ländern zu fördern. Die Geschichte geht weiter. „Die Gegenwart ist immer die Summe aller heutigen Möglichkeiten“, sagte Raymond Aron. Es liegt jetzt an den Jüngeren, sich für die Konsolidierung eines Europas einzusetzen, das stolz darauf ist, föderalistisch und humanistisch zu sein.
JEF: Nach dieser Einordnung deines Lebens in eine historische Perspektive, erzähle uns von den 18 Jahren, die du an der Ecole des Ponts verbracht hast, wo du die Leitung der Abteilung für Sprachen und Kulturen innehattest.
JEA: Warum nicht? Es stimmt, dass man vieles so schnell vergisst, vor allem in einer Zeit, in der sich alles auf schwindelerregende Weise beschleunigt. Man kann meine Jahre von 2004 bis 2022 an der Ecole des Ponts in drei Phasen unterteilen. Zunächst eine Phase der Befriedung, die notwendig war, da 2004 innerhalb der Abteilung eine sehr konfliktträchtige Atmosphäre des Misstrauens herrschte. Ich werde mich immer an die Unruhe erinnern, die ich durch die einfache Ansetzung einer Dienstbesprechung für alle festangestellten Lehrkräfte ausgelöst habe. Man hatte den Verdacht, dass der neue Leiter Entlassungen ankündigen wollte! Du kannst dir kaum das Ausmass meiner Verwunderung vorstellen!
Der einzige Grund für diese Sitzung war der Vorschlag, den Kongress der Union des Professeurs de Langue des Grandes Ecoles (UPLEGESS) im Jahr 2006 in Les Ponts zu organisieren, und ich war naiv genug zu glauben, dass ein solches kollektives Projekt ein ausreichendes Mittel darstellte, um alle meine Kollegen zu vereinen. Der Kongress fand schließlich statt, aber ich musste auf die Unterstützung der damaligen Schulleitung zählen, damit eine von einigen Kollegen organisierte Kabale ad hominem gestoppt wurde. Diese Kabale zielte schlicht und einfach auf die Entlassung des neuen Abteilungsleiters ab. Die Kolleginnen, die hinter diesen bösartigen Machenschaften steckten, ermöglichten es mir hingegen, mich eingehend mit dem psychologischen Phänomen der Projektion zu beschäftigen.
Die zweite Phase von 2010 bis 2014 war hauptsächlich der Einführung eines authentischen Qualitätsansatzes gewidmet. Die Abteilung schuf in dieser Zeit eine humane und stimulierende Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der auch heute noch gültig ist.
JEF: Können wir noch einmal etwas ausführlicher auf diese Phase der kontinuierlichen Verbesserung eingehen, die du als „authentisches“ Vorgehen bezeichnest? Was bedeutet dieses Wort für dich?
JEA: Das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Wozu soll eine Qualitätsinitiative dienen? Was ist ihr eigentlicher Zweck? Wie in der ARTE-Serie „En thérapie“ so treffend festgestellt wird, leben wir in einer Zeit, in der „alles fragmentiert ist in einem Phantasma der Perfektion“. Unter dieser Art von kollektivem Wahnsinn leiden viele Menschen. Barbara Stiegler hat diesen „neuen politischen Imperativ“ unserer heutigen ultra-neoliberalen Gesellschaft in ihrem Buch „Il faut s’adapter“ brillant analysiert.
In der Tat tritt die Sorge um Qualität heute in zwei entgegengesetzten, aber oberflächlich betrachtet ähnlichen Formen unserer Diskurse auf. Mit Valérie Darthout, die damals für die Qualität bei Les Ponts zuständig war, fassten wir einmal unsere Erfahrungen zusammen, indem wir den echten Qualitätsansatz klar vom rein kosmetischen Ansatz trennten. Letzterer zielt nur darauf ab, ein Gütesiegel zu erhalten, indem die Arbeitsrealität so wenig wie möglich verändert wird. Ein authentischer Ansatz hingegen zielt auf eine Veränderung dieser Realität ab, indem er alle Akteure der Organisation einbezieht und ihnen im Idealfall ein besseres Wohlbefinden am Arbeitsplatz verschafft. Der Erhalt des FLE-Qualitätssiegels war auch das Ergebnis einer solchen solidarischen Teamarbeit.
Es gibt nicht viele Autoren, die es verstehen, die menschliche Herausforderung der „authentischen Qualität“ treffend zusammenzufassen. Ich möchte den Leser auf das großartige Buch von Pascal Chabot „Traité des libres qualités“ verweisen, in dem sichfolgende erhellende Feststellung findet: „Eine offene Philosophie müsste sich angesichts der durch das technische Zeitalter bedingten starken Beschränkungen zum Ziel setzen die freien Qualitäten zu unterstützen, d.h. die Qualitäten, die man entwickeln will um das Leben geniessen zu können. Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, den Wert der Qualität mit den Forderungen nach Freiheit und dem Bedürfnis nach Gerechtigkeit zu verbinden. Die Herausforderung ist groß, wenn wir eine gemeinsame Welt aufbauen wollen, in der unsere verschiedenen Lebensarten gedeihen können.“
JEF: In der Tat! Man kann es nicht klarer und … weitsichtiger formulieren! Wie würdest du die letzte Phase charakterisieren, nachdem euer Team sich einmal auf einen echten Qualitätsprozess eingelassen hatte?
JEA: Die Jahre von 2014 bis heute sind die Jahre der Kreativität und der pädagogischen Innovation, in denen das Angebot an Sprachkursen vielfältiger wurde und die zielstrebige Arbeitsdynamik des Teams sich in einem ruhigeren Fahrwasser entwickeln konnte. Es gelang uns, Veränderung und Offenheit gegenüber neuen pädagogischen Praktiken zu kombinieren mit dem, was sich pädagogisch bewährt hatte. Ein vielsagendes Zeichen dafür war der Namenswechsel der Abteilung. Der irreführende Name „Abteilung für Sprachausbildung“ wurde durch „Abteilung für Sprachen und Kulturen“ ersetzt. Das gesamte Team hat sich mit viel Energie, Menschlichkeit und Effizienz der Betreuung all unserer französischen und internationalen Studenten gewidmet!
Das attraktive Kursangebot fördert heute die Entwicklung von Kreativität, Selbstvertrauen und Kenntnis des Anderen beim Gebrauch der „fremden“ Sprache, ohne dass dabei die sprachlichen Anforderungen vernachlässigt werden, die auf ein sehr gutes Niveau im schriftlichen und mündlichen Bereich abzielen. Bewährt haben sich Situationsbewältigungen durch Redewettkämpfe, Theater, körperorientierte und künstlerische Ansätze, Tandems sowie Kurse zum kreativen Schreiben und zur interkulturellen Erfahrung. Die Bewertungen der Sprachkurse durch die Studenten und durch die Commission des Titres (CTI) sind hervorragend. Ich freue mich natürlich darüber, im Audit der CTI zu lesen, dass der Sprachunterricht eines der sehr positiven Elemente der Ausbildung der Ecole des Ponts ist.
JEF: Welcher Pädagoge wäre für dich nach so vielen Jahren als Lehrer eine Art Pflichtleküre für die jungen Lehrer von heute?
JEA: Das ist schwer zu beantworten, aber ich nehme die Herausforderung deiner Frage an. Ich würde jungen Kollegen unbedingt raten, die Bücher von John Dewey zu lesen.
JEF: Warum?
JEA: Dewey hat das Phänomen der Erfahrung in den Mittelpunkt seines philosophischen Denkens und seiner praktischen Arbeit als Pädagoge gestellt. Nur die Erfahrung, und vor allem die Erfahrung der Autonomie des Lernenden, hat eine wirkliche transformative und performative Kraft. Dewey hat meisterhaft aufgezeigt, dass die Herausforderungen der Bildung völlig untrennbar mit der Demokratie verbunden sind. In einer Zeit, in der die Grundlagen und Strukturprinzipien der pluralistischen Demokratie immer öfter explizit in Frage gestellt oder sogar abgelehnt werden, ist die Lektüre von Dewey unerlässlich.
JEF: Hast du noch andere schöne Erinnerungen, die dein Herz für den Rest deines Lebens höher schlagen lassen? Oder gibt es Projekte, die dir noch am Herzen liegen?
JEA: Natürlich. Ich habe diesen mehrsprachigen Kontext, in dem sich meine Arbeit abgespielt hat, wirklich über alles geschätzt. Madame de Staël hat einmal gesagt: „Alles, was natürlich ist, ist vielfältig“. In unserer Hochschule täglich so viele Sprachen zu hören und jeden Tag Lehrer zu treffen, die Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch oder Spanisch unterrichten, und mich mit ihnen über „Gott und die Welt“ austauschen zu können, war für mich ein außerordentliches Vergnügen. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass ich Projekte in der Schule wie die Tandemarbeit, aber auch außerhalb unserer Hochschule bei UPLEGESS und der Conférence des Grandes Ecoles entwickeln konnte, die alle zum Ansehen der Ecole des Ponts beigetragen haben. Ich möchte hier nur fünf besonders bezeichnende Beispiele nennen:
Der UPLEGESS-Kongress in Les Ponts im Jahr 2006 zum Thema „Internationalisierung unserer Ausbildungen“ mit einem unvergesslichen Vortrag des Philosophen François Jullien, der über das Universelle, das Uniforme, das Gemeinsame und den Dialog zwischen den Kulturen sprach.
Der IDEA-Tag von 2016 „Lernen, begleiten und ausbilden durch Tutoring: Rolle und Arbeitsformen des ‚emergenzorientierten Tutors‘“.
Das internationale Kolloquium im Jahr 2018 zum Thema „Gouvernance linguistique des établissements de l’enseignement supérieur“, das vom Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP), der Universität Paris Diderot, der Ecole polytechnique, der Ecole des Ponts und der Union der Sprachlehrer der Grandes Ecoles (UPLEGESS) organisiert wurde.
Die Einführung des Programms für geflüchtete Studenden (Programme des étudiants réfugiés PER), das unsere Abteilung dank des entschlossenen Engagements, der Begeisterung und der Professionalität des DLC-Teams ins Leben gerufen hat.
Ich freue mich auch sehr, dass ich kürzlich für die Ponts an der Produktion des MOOC des Institut Mines Télécom und der Télécom „Un carnet interculturel pour une mobilité universitaire“ mitwirken konnte.
Es bleibt mir heute noch das Vergnügen, die Veröffentlichung eines zweiten Buches mit den Presses des Ponts vorzubereiten. Es wird im Anschluss an das erste Buch mit dem Titel „L’ingénieur citoyen“ erscheinen und erneut mehrere Artikel über die Bedeutung des Sprachenlernens für die zukünftigen Ingenieure und Manager enthalten. Es ist mehr denn je von grosser Bedeutung, dass Ingenieure und Manager mehrsprachig sind.
JEF: Wenn ich dir zuhöre, möchte ich dir eine Frage zum Thema Management stellen. Was bedeutet es für dich, ein guter Manager zu sein?
JEA: Ich habe darauf gewartet, dass du mir eine solche Frage stellst. Wir haben ja oft darüber diskutiert, was eine „gute Managementkultur“ sein könnte, nicht wahr? Du weißt, dass ich das Wort „Management“ nicht mag. Seine lateinischen Wurzeln bringen es zu sehr in die Nähe von „Manipulation“ und „Dressur“. Ich misstraue jeder Form von vertikalem bzw. pyramidalem Management, das nicht ohne Hofstaat und Höflinge und d.h. ohne freiwillige Knechtschaft funktioniert. Der dänische bildende Künstler Olafur Eliasson hat unser aktuelles Problem sehr gut zusammengefasst: „Die Menschen haben das Zweifeln verlernt, man verlangt von ihnen, affirmativ und selbstsicher zu sein. Aber man braucht auch Leute, die sich nicht sicher sind!“ Wir brauchen sie, um in unseren Entscheidungsprozessen kontroverse Debatten zu ermöglichen und systematisch zu praktizieren. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung dafür, das Risiko, „absurde Entscheidungen“ zu treffen (das Christian Morel so gut analysiert hat), auf ein Minimum zu reduzieren.
JEF: Wie sah dein Kompass aus für die Navigation auf der stürmischen See der Teamkoordination?
JEA: Ich habe mir zum Ziel gesetzt, einen Rahmen zu schaffen, der stabil genug und gleichzeitig flexibel genug ist, um einen Raum für Kreativität und Resonanz in unserem Team entstehen zu lassen. „Betreuer zu sein“ bedeutete für mich, wie ein Trainer zu agieren, zu ermutigen durch Anerkennung, um sich gemeinsam neue Dinge auszudenken und sie gemeinsam zu tun, indem man sie auf intelligente Weise mit einer bewährten pädagogischen Praxis kombiniert.
Ich entwickelte die Vorstellung, als „emergenzorientierter Tutor“ zu agieren, die einzig mögliche Rolle für jemanden, der darauf abzielt, ein Team in die Dynamik des Lebendigen einzufügen. Um diese Rolle in aller Bescheidenheit zu spielen, habe ich mir immer die Frage gestellt: Hast du wirklich zugehört, was der andere gesagt hat? Natürlich habe ich nicht immer gut zugehört, aber ich denke, meine Fähigkeit zuzuhören hat sich mit den Jahren verbessert. Das Zuhören geht der Rede voraus, da diese sich ja immer an ein bestimmtes Publikum in einem ganz bestimmten Zeit-Raum richtet. Muss man nicht zuerst genau zuhören, bevor man das Wort ergreift? Ist nicht jede Rede im Grunde genommen eine Antwort, die man an jemanden richtet? Wenn das Unterrichten von Sprachen der schönste Beruf der Welt ist, dann deshalb, weil wir im Grunde genommen zunächst einmal das aktive Zuhören lehren, ohne das man nicht lernen kann, eine neue Sprache zu sprechen.
Wir tun gut daran, über Heraklits Fragment 19 nachzudenken: „Da sie nicht zuhören können, können sie auch nicht sprechen.“ Marguerite Yourcenar erzählt in „Mémoires d’Hadrien“ eine Szene, die dieselbe Herausforderung widerspiegelt: Kaiser Hadrian wird auf einer Reise von einer alten Frau angesprochen. Müde wendet er sich ab und setzt seinen Weg fort. Da hält sie ihn zurück und sagt: „Wenn du keine Zeit hast, mir zuzuhören, hast du auch keine Zeit zu regieren“. Das ist die radikale Herausforderung jeder Rede: Sie muss vor allem das Ergebnis eines großen Zuhörens sein!
JEF: Und welcher Art von Management misstraust du am meisten?
JEA: Dem Management, das sich ausschliesslich an Zahlen orientiert! Mit Zahlen kann man alles machen. Zahlen sind die bevorzugten Argumente von modernen Führungskräften, für die Manipulation zur zweiten Natur wurde. Ein Satz, der mich tief beeindruckt und dadurch stark geprägt hat, ist der folgende von Isabelle Stengers: „Eine Zahl kann eine andere verstecken, und sie kann sogar ein Phänomen verbergen, für das es keine Zahlen gibt.“ Der menschliche Faktor lässt sich niemals auf Zahlen reduzieren. Dass es wichtige Zahlen gibt, die in Politik und Verwaltung und bei der Leitung eines Teams berücksichtigt werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber den Menschen nur auf Zahlen zu reduzieren, ist eine erschreckende Fehlentwicklung.
JEF: Eine solch radikale Position dürfte in einer Ingenieurschule nicht gerade leicht zu vermitteln sein, oder?
JEA: Ja, natürlich. Saint-Simon hatte aber diese Tendenz zu seiner Zeit schon treffend formuliert: „Die Verwaltung von Dingen wird die Regierung von Personen ersetzen. Die neuen Honoratioren werden die Ingenieure sein.“ Umso wichtiger ist es, dass wir wissen, wo wir in Bezug auf diese beiden Paradigmen stehen. Ich habe jedenfalls versucht, dies zu tun, indem ich so oft wie möglich den Menschen den Vorrang vor den Dingen gegeben habe; indem ich eher der Weisheit als den Naturgesetzen den Vorrang gegeben habe; eher den Künsten als der Technologie; eher dem subjektiven Sinn als der objektiven Wahrheit; eher dem Verständnis als der Erklärung; eher den Worten und Symbolen als den Zahlen und Formeln; eher der Einzigartigkeit als der Universalität; eher der Handlung als dem Modell; eher dem Gefühl als der Vernunft, kurz: eher dem Geist der Finesse als dem Geist der Geometrie.
JEF: Das Erlernen einer Sprache würde sich also nicht auf das Erlernen einer „grammatikalischen Geometrie“ beschränken?
JEA: So wie man nicht schwimmen lernen kann, indem man ein Buch über die menschliche Anatomie auswendig lernt, so muss man eines Tages ins Wasser springen, um die Erfahrung des Schwimmens zu machen. Das Sprechen ist immer eine „Tat“, eine Aktion, die eine starke symbolische, sinnliche und leibliche Verpflichtung ausdrückt, die uns berührt und unser Innerstes betrifft. Der Sprachlehrer ist eine Art Fährmann, der dabei hilft, in einer anderen Sprache wiedergeboren zu werden. Es ist gerade die Erfahrung der „Kluft zwischen den Sprachen“, von der François Jullien spricht, die die Entwicklung des Feingeistes fördert.
JEF: Kannst du die Gründe, warum unsere Ingenieure idealerweise mehrsprachig sind, weiter ausführen?
JEA: Seit Heraklit wissen wir, dass wir immer von der Realität abgeschnitten sind. Es ist zum Beispiel unmöglich, einer Person, die diesen Käse noch nie gegessen hat, den Geschmack von Camembert zu erklären. Clément Rosset demonstrierte mit viel Humor dieses Dilemma, das unsere Bemühungen, uns verständlich zu machen, kennzeichnet. Die Sprache ist der „harte Kern“ des menschlichen Daseins, da sie das einzige Mittel ist, diese Leere mit einem stets vorläufigen Sinn zu „füllen“. Unsere Worte sind Flaschen, die wir in das unendliche Meer des Impliziten werfen in der Hoffnung, dass sie am anderen Ufer von jemand geöffnet werden. Die Philosophen haben uns das immer schon gesagt, angefangen mit Heraklits Fluss, in dem man nicht zweimal steigen kann, über Bergson und sein Buch „Die schöpferische Evolution“ bis hin zu Bruno Latour, der kurz vor seinem kürzlichen Ableben ein „Kompositionistisches Manifest“ veröffentlichte.
Unsere Welt ist immer im Wandel begriffen, und eine gemeinsame Welt muss immer von neuem aufgebaut werden, in allen Momenten und auf allen Ebenen unseres Daseins, auf der Ebene eines Paares, einer Familie, eines Teams, eines Unternehmens und auf der Ebene einer ganzen Gesellschaft. Wenn unsere gemeinsame Welt immer neu aufgebaut oder stabilisiert werden muss, kann man bei dem Versuch, sie aufzubauen, auch scheitern. Mehr denn je ist diese gemeinsame Welt, die es aufzubauen gilt, komplex und durch das Vorhandensein einer großen Anzahl von Sprachen gekennzeichnet. Jede Sprache hat ihren eigenen Genius, um ihre Beziehungen zur Welt aufzubauen. Nur durch die Übersetzung zwischen den Sprachen wird es uns gelingen, ein Maximum der vielfältigen Bedeutungen dieser komplexen Welt einzufangen. Daher die Notwendigkeit, die mehrsprachigen und interkulturellen Kompetenzen zu vervielfachen, um versierte Mediatoren auszubilden, die Sprachen und „Weltanschauungen“ übersetzen können. Aber Vorsicht: Man muss sich immer vor Augen halten, dass es darum geht, eine gemeinsame Welt aufzubauen und keineswegs eine exklusive Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Eichmann Hebräisch gelernt hat, um bei der Organisation der Endlösung effektiver zu sein.
JEF: Man merkt, dass du ein Kind des Kalten Krieges bist und dass die deutsche Vergangenheit dich immer wieder einholt. Befürchtest du nicht, dass diese Erinnerung an Eichmann kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, für einen mehrsprachigen Unterricht einzutreten?
JEA: Diese Erinnerung an Eichmann dient einzig und allein dazu, uns vor jeder Form der oberflächlichen Verteidigung von Sprachen zu warnen, die zu idealistisch ist, um wahr zu sein. Jede Sprache kann (wie die Religion, die Kultur usw.) instrumentalisiert werden, um den Interessen irgendeiner ideologischen Macht zu dienen. Das war in der Geschichte oft der Fall und ist es natürlich auch heute noch. Jeder Sprachlehrer muss sich daher dieser ethischen Herausforderung seines Berufs bewusst sein. Er muss sich so ehrlich wie möglich die Frage stellen: Was ist der Zweck meines Unterrichts? Trage ich wirklich zum Aufbau einer gemeinsamen Welt bei? Etwa durch die Art der Steuerung der Gruppendynamik in meiner Klasse, durch meine Lehrmethoden, durch die behandelten Themen und die gewählten Materialien? Oder beteilige ich mich mehr oder weniger bewusst an der Aufrechterhaltung einer exklusiven Welt, indem ich beispielsweise meine Sprache als die einzige ansehe, die es wert ist, gelernt zu werden, oder indem ich sie für wichtiger halte als andere Sprachen, die in demselben sozialen Raum vertreten sind? Eine Bildungspolitik, die die Mehrsprachigkeit fördert, ist das beste Mittel, um gegen jede Form der sprachlichen und kulturellen Hegemonie anzukämpfen. Mehrsprachigkeit ist der fruchtbare Nährboden für kritisches Denken. Ich denke, es ist an dieser Stelle nicht notwendig, Beispiele für diese exklusiven Welten zu nennen, die heute von ihren Anhängern verteidigt werden. Unsere Nachrichten sind immer öfter bis zu einem unerträgliches Mass voll davon.
JEF: Wenn du den Sprachlehrer mit einer solchen Aufgabe betraust, riskierst du dann nicht, ihn zu entmutigen?
JEA: Genau diese Aufgabe hat mich motiviert und meiner Arbeit einen so starken Sinn verliehen! Ich kenne viele Kollegen, die den Beruf des Lehrers auf dieselbe Weise verstehen. Ihr Ziel ist es, eine gemeinsame Welt aufzubauen, indem sie mehrsprachige Vermittler ausbilden. Sie wissen, um es mit Michel Serres zu sagen, dass letztlich „alles Lernen aus einer Vermischung besteht“.
JEF: Schließlich müssen wir auch in uns selbst eine gemeinsame Welt erschaffen, um in Harmonie zu leben und unser Leben genießen zu können. Ich schlage dir vor, zum Abschluss unseres Gesprächs einen dritten Jörg Eschenauer hinzuzufügen, da ich glaube, dass wir beide allein nicht in der Lage sind, die Vielfalt unseres Inneren zu repräsentieren.
JEA: Ja, das stimmt. Wir sind alle lebende Organismen, zusammengesetzt und komplex. Ich glaube, wir können unseren Austausch tatsächlich nicht beenden, ohne dem ängstlich-besorgten JEB, der unser unumgänglicher Mitbewohner ist, das Wort zu erteilen.
JEF: Danke, dass du dich zu uns gesellst, um zu dritt über deine Beziehung zur Welt zu sprechen, die von einer sehr großen Sorge geprägt ist.
JEB: Leider erlaubt es unsere Zeit nicht mehr, besorgte, pessimistische Charaktere wie mich zu ignorieren. Was kann ich für euch tun?
JEF: Erkläre uns die Gründe für deine tiefe Besorgnis!
JEB: Ich bin sehr besorgt über den Zustand der Welt, in der ich meine Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehe. Erlaubt mir, mich selbst zu zitieren. In meinen „ungewöhnlichen Wünschen für eine unvernünftige Zeit“, die ich Anfang 2021 an meine Freunde und Kollegen geschickt habe, heißt es: „Historiker, die sich für die lange Dauer von Geschichtsprozessen interessieren, wissen es seit langem. Man muss nicht an die ewige Wiederkehr glauben, um das Stottern der Menschheit und die Wiederholung großer Krisen im Abstand von drei oder vier Generationen festzustellen. Ein Jahrhundert nach einem großen traumatischen Ereignis ist die lebendige Weitergabe unterbrochen. Wenn man nur die letzten fünf Jahrhunderte betrachtet, zeigt unser Europa diese regelmäßige, gefährliche Rückkehr des „Schlafs der Vernunft, der Ungeheuer zeugt“ (Goya). Jeder Beginn eines Jahrhunderts kennt seine dramatischen Ereignisse, die herannahende Krisen und Kriege ankündigen: die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts, die Erbfolgekriege im 18. Jahrhundert, die Napoleonischen Kriege im 19. sowie der Große Krieg im 20. mit den so schnell gescheiterten Friedensverträgen von Wien und Versailles…! Wie die Schlafwandler des Jahres 1914 erleben wir heute erneut den kritischen Moment eines hochriskanten Jahrhundertbeginns. Wir befinden uns wieder in einer Phase des Schlafs der Vernunft, die die schlimmsten Katastrophen hervorbringen kann. Zu dem üblichen Drama der Menschheit kommen heute die neuen technologischen Risiken hinzu. „Jetzt zittern wir in der Nacktheit eines Nihilismus, in dem die größte Macht und die größte Leere, die größte Leistung und das völlige Fehlen des Wissens, wozu das alles gut ist, zusammenkommen.“ Diese Feststellung von Hans Jonas (in „Das Prinzip Verantwortung“ von 1979) hat nichts von ihrer Relevanz verloren, sondern ist im Gegenteil von zunehmend beunruhigender Aktualität.“
JEA: Es ist in der Tat erstaunlich, eine solche Feststellung nur wenige Monate vor dem Überfall der Ukraine durch Putins Russland zu hören.
JEB: Diese vorausschauenden Gedanken sind nicht sehr originell. Man muss nur realistisch sein, den Lauf der Geschichte betrachten und sich nicht der Verdrängung der Risiken hingeben, die auf uns lasten. Wie ist es möglich, dass ein Staatsterrorist wie Putin seit mindestens zwei Jahrzehnten sein perverses geopolitisches Spiel spielen konnte, ohne dass unsere Politiker den Braten gerochen haben? Dabei waren wir alle über die grausame Behandlung informiert, die der Despot im Kreml seinen Gegnern angedeihen lässt. Deren Namen darf jetzt niemand mehr ignorieren: Alexej Nawalny, Jewgeni Rojsman, Wladimir Kara-Murza, Ilja Jaschin oder Boris Nemzow, der vor acht Jahren feige ermordet wurde, nachdem er die Welt vor der geplanten Aggression Russlands gegen die Ukraine gewarnt hatte. Es ist zu befürchten, dass viele unbekannte Oppositionelle die gleiche unmenschliche Behandlung erfahren haben und noch erfahren werden.
Meine Besorgnis im Übrigen verwandelt sich immer häufiger in Wut. Ich spreche hier vom Zorn wie dem Zorn Jesu, als er die Tische der Händler umwarf, die ihre Geschäfte auf dem Tempelgelände abwickelten und das Haus Gottes in eine „Banditenhöhle“ verwandelten. Auch Thomas Müntzer, der uns nähersteht, zeigt uns dies. War sein Zorn nicht die einzige wirklich angemessene Reaktion auf die Unzumutbarkeit der extremen Armut der Bauern seiner Zeit? Und was tut Spinoza, wenn er den kriminellen Charakter der Regierung seiner Zeit kritisiert? Er ist so entsetzt über die unglaublich grausame Ermordung von Gegnern des herrschenden Regimes, dass er vorhatte, ein Plakat an die Wand in der Nähe des Ortes des Attentats zu kleben, auf dem er den Terror der „ultimi barbarorum“, der „schlimmsten aller Barbaren“, anprangert. Um so zu handeln, musste unser Philosoph der Freude die Erfahrung der Wut machen, um seine Empörung auszudrücken und auf seiner bescheidenen, aber umso beispielhafteren Ebene die Gedankenfreiheit zu verteidigen.
Wir kennen andere Beispiele für eine gerechtfertigte Wut. War es nicht eine starke Wut, die Georg Elser dazu brachte, das Böse in der Person Hitlers ausmerzen zu wollen? Dieser Zorn verwandelte sich in eine langsame und entschlossene Handlung. Er bezahlte seinen so mutigen Versuch, den „Führer“ im November 1939 zu töten, mit seinem Leben! Wohlgemerkt im Jahr 39! Er bereitete sein Attentat vor, indem er wochenlang jede Nacht ein Loch in einen Pfeiler grub, unter dem Hitler am 9. November seine Rede halten sollte. Die Realität der deutschen Gesellschaft machte Georg Elser krank. Die Wut steigerte seine Tatkraft und seinen Mut.
Heute spüren wir eine Wut, die auf die obszöne Gier derjenigen reagiert, die sich weigern, die Umverteilung eines Teils ihres völlig sinnlosen Reichtums auf den Rest der Gesellschaft zu akzeptieren. Man muss nur die Arbeit von Lucas Chancel über die Entwicklung der Ungleichheit in der Welt lesen. Die ultra-neoliberale Ordnung, die 1989 mit dem Washingtoner Konsens ins Leben gerufen wurde, hat ein atemberaubendes globales Durcheinander geschaffen. Man kann Kunderas berühmten Satz aus „Der Witz“ aufgreifen und ihn auf unsere Zeit anwenden: „Optimismus ist das Opium unserer ultra-neoliberalen Gesellschaft.“
Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Revolte und Wut die einzigen angemessenen Antworten auf diesen dummen Optimismus sind, der viele Reden und Entscheidungen unseres politischen Führungspersonals kennzeichnet, die sich beispielsweise auf die angeblichen Vorteile der Digitalisierung unserer Mentalitäten, unseres völlig aus den Fugen geratenen Wirtschaftssystems und unserer ungerechten Sozialpolitik beziehen. Ganz zu schweigen von seiner Heuchelei in Bezug auf die Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Klimaerwärmung. Was an der Funktionsweise unserer Gesellschaften empörend ist, ist die Tendenz unserer Regierenden, „schwach mit den Starken und stark mit den Schwachen“ zu sein, wie Philippe Corcuff es so treffend formuliert hat.
JEA: Woher kommt bei dir diese so tiefe Revolte?
JEB: Ist der gegenwärtige Zustand unserer Welt nicht elend genug, um sie zu rechtfertigen? Vielleicht liegt ein Teil der Antwort auf diese Frage in dem, was du die biopoetische Dimension unseres Lebens genannt hast. Ich möchte uns daran erinnern, warum wir Jörg heißen. Dieser von unserer Mutter gewählte Name war 1955 überhaupt nicht in Mode. Mein Großvater Emil, ein Mann, der zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs geboren wurde, mochte diesen Namen nicht. Meine Mutter wollte sicherlich mehr oder weniger bewusst ein Zeichen setzen, indem sie uns diesen Namen zwei Jahre nach dem Aufstand der Ostdeutschen am 17. Juni 1953 gab.
Man muss wissen, dass Luther während der Zeit seines Rückzugs auf die Wartburg das Pseudonym „Junker Jörg“ trug. Luther musste sich verstecken, weil er zum Tode verurteilt war und als „vogelfrei“ erklärt worden war. Jeder hatte das Recht, ihn ungestraft zu töten. Warum war das so? Weil er es gewagt hatte, dem Papst 1521 in Worms zu sagen, dass er seine Meinung nicht ändern würde: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ Widerstand ist immer eine Frage des Gewissens, nicht wahr? Aber auch hier ist die übliche französische Übersetzung des deutschen Wortes „Gewissen“ mit „Bewusstsein“ („conscience“) nicht zufriedenstellend. Es handelt sich eben um eine bestimmte Form des Bewusstseins. „Unser Gewissen“ ist unser ethisch begründetes Bewusstsein von Gut und Böse, eine innere Stimme, die uns mahnt, gerecht zu sein, und die uns immer wieder in Erinnerung ruft, dass wir Verantwortung tragen. „Gewissen“ ist ein Wort, das es in der französischen Sprache leider nicht gibt.
JEA: Gibt es eine Person, die für dich ein Vorbild in unserer so unruhigen Zeit darstellt?
JEB: Ohne zu zögern würde ich sagen, dass für mich Stéphane Hessel ein wirklich grosses Vorbild ist. Er war der Vermittler par excellence. Ich werde meine sehr flüchtige Begegnung mit ihm bei einem Empfang in der deutschen Botschaft nicht vergessen. Als ich mich mit meinem Glas in der Hand umdrehte, stand ich ihm zufällig gegenüber, während er sich mit Simone Veil unterhielt. Sehr schnell entfernten sich die beiden und ließen mich allein und sprachlos zurück. Es war ein Geschenk für den passiven Zeugen, der ich war, durch ihren kurzen Austausch die ganze Komplizenschaft und Freundschaft zu spüren, die ihre Beziehung kennzeichnete.
Stéphane Hessel war auch der Initiator der Gründung der Sections internationales de Sèvres im Jahr 1962, für die ich zwischen 1992 und 2004 als Lehrer gearbeitet habe. Hessel zeigt uns durch die ethische Kohärenz seines Lebens, wohin wir versuchen sollten zu gehen. Er war deutscher Herkunft, wurde Franzose, Widerstandskämpfer, erlitt die Deportation, wurde nach 1945 Botschafter und blieb bis zum Ende seines Lebens ein unermüdlicher Verteidiger aller Arten von „Sans Papiers“. Mit seinem Manifest „Indignez-vous!“ („Empört euch!“) setzte er ein beindruckendes Signal. Was für ein beispielhaftes Leben!
Ja, empören wir uns! Um es mit den Worten von Jean Malaurie zu sagen, der uns auch mit seinem beispielhaften Leben als Widerstandskämpfer gegen die Naziordnung und später mit seinem Engagement für die Inuit von Thulezu zu ermutigen vermag: „Lasst uns nicht zu einem Volk von Ameisen werden, das durch Wort, Bild und Computer manipuliert wird. Lasst uns etwas wagen, Widerstand leisten und Abenteuer erleben“. Ich finde, ein besserer Abschluss unserer kleinen Plauderei lässt sich nicht finden, nicht wahr?
JEF: In der Tat! Ich danke euch beiden für den offenen Austausch zwischen uns.
JEA: Die Fragen haben mir geholfen, elastisch mit uns umzugehen und mich und uns besser zu verstehen.
JEB: Vielen Dank, dass ihr mich in diese Plauderei unter Freunden einbezogen habt! Ich wünsche euch alles Gute! Möge unsere Empörung über die Zeitumstände und unsere wechselseitige Neugier zu weiteren kleinen Plaudereien unter Freunden führen!
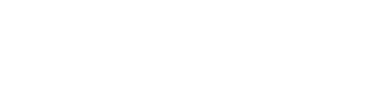

Responses